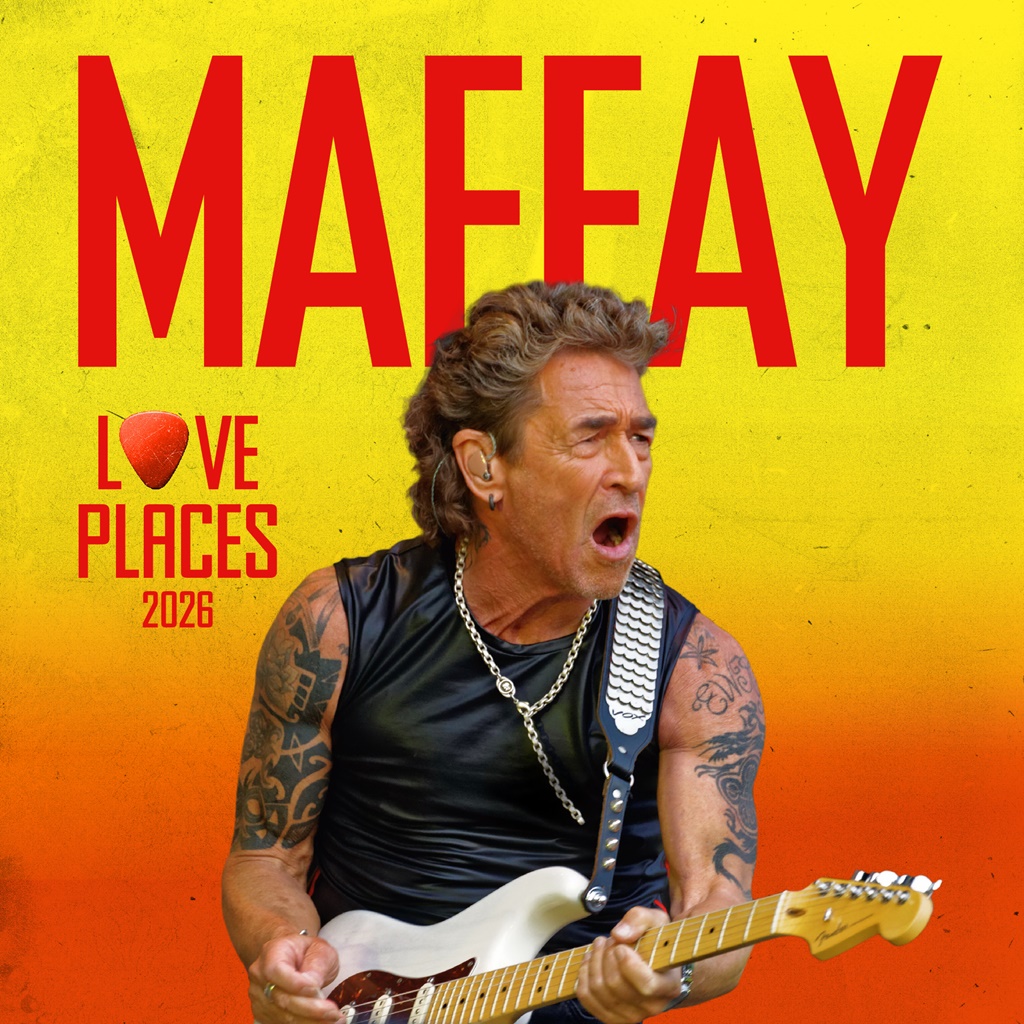Dranner bleiben
Am 7. März 2010 traten sich in den Fernsehstudios von München bis Babelsberg deutsche Produzenten und Regisseure gegenseitig in den Hintern. Der Grund: Jahrelang stand eines der größten Talente des europäischen Films vor ihren Kameras – und anstatt Christoph Waltz die Traumrollen anzubieten, die ihm aufgrund seines Talents zustanden, hatten sie den Österreicher mit TV-Serien wie „Kommissar Rex“ und Nebenrollen abgespeist. Und jetzt? Gewann Christoph Waltz einen Oscar für seine Rolle des SS-Standartenführers Hans Landa in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“.
„Es gab Augenblicke in meiner Karriere“, sagt Christoph Waltz, „da war ich am Scheideweg.“ Zweiundzwanzig Jahre sind seit dem Deutschen Schäferhund vergangen, wir befinden uns in einem luxuriösen Hotelzimmer im kalifornischen Santa Monica.
Christoph Waltz lächelt sein Hans-Landa-Lächeln, jenes überheblich-zynische Grinsen, Spott gepaart mit Sadismus und Genie, das ihn zum doppelten Oscar-Gewinner machte und seine Karriere in Hollywood auf Lebenszeit sicherte. Tarantino hatte damals lange und vergeblich nach demjenigen gesucht, der diese Rolle spielen konnte. Der „New York Times“ sagte er einmal, dass er wusste, „dass Landa eine der besten Rollen war, die ich je geschrieben habe. Ich begann allerdings, mir langsam einzugestehen, dass niemand die Rolle spielen konnte“.
Allein die Anfangssequenz nimmt im Drehbuch 17 Seiten ein. Mit ihr schrieb Christoph Waltz nicht nur Filmgeschichte, sie war auch der Startschuss für seine internationale Karriere. An Intensität wird die Eröffnung nur durch die infame „Strudel-Szene“ übertroffen, in der Waltz nicht nur einen Apfelstrudel zerstört, sondern auch die Nerven der Zuschauer.
Waltz war schon 52 Jahre alt, nicht gerade ein ideales Alter für einen Karriere-Start im von Jugend besessenen Hollywood, als der – auch für ihn überraschende – Durchbruch kam. Trotz des späten Erfolgs zählt Christoph Waltz heute zu Hollywoods Top-Liga. Jeweils zwei Oscars („Inglourious Basterds“ und in Tarantinos Anti-Sklaverei-Epos „Django Unchained“), Golden Globes und BAFTAs, ein Sieg in Cannes und einmal Gastgeber in der Comedy-Show „Saturday Night Live“ machten ihn zu dem, was man im Filmgeschäft einen „bankable star“ nennt, einen Publikumsmagneten, auf dessen Zugkraft man international setzen kann.
„DER BÖSE IST LEIDER EINE NISCHE, WEIL ES DIE INTERESSANTESTEN ROLLEN SIND.“
Er spielte den Erzbösewicht Oberhauser in James Bonds „Spectre“ und ersetzte Al Pacino als Qohen Leth in Terry Gilliams „The Zero Theorem“. Roman Polanski besetzte ihn im Psycho-Drama „Der Gott des Gemetzels“ und in „Legend of Tarzan „, und in „Water for Elephants“ gibt er den zynischen Schurken. In seinem neuen Film hingegen, dem Sci-Fi-Spektakel „Alita – Battle Angel“ von „From Dusk Till Dawn“- und „Sin City“-Regisseur Robert Rodriguez, ist er auf der Seite der Guten – als Produzent fungierte James Cameron.
Hat man Angst, als deutschsprachiger Schauspieler als ewiger „Baddie“ abgestempelt zu werden? Ein Journalist nannte ihn einmal den furchteinflößendsten Mann in Hollywood. „Das ist mir ehrlich gesagt wurscht“, winkt er ab. „Da fragt man sich, wer das gesagt hat.“ Ein Londoner Journalist. Waltz zuckt nonchalant mit den Schultern. Who cares?
„Der Böse ist leider eine Nische, weil es die interessantesten Rollen sind“, fügt er hinzu. „Der Held ist ja nix wert, wenn er keinen Antagonisten hat, der ihm zum Heldentum Anlass gibt. Diese Rollen verlieren in zunehmendem Maße ihre Faszination, weil sie sich der Marktwirtschaft in einer Weise unterwerfen, die dem Drama, nach dem wir als Zuschauer eigentlich dürsten, nicht nachkommt.“
Der Wiener Waltz ist witzig und charmant und zuvorkommend und intelligent und ausgezeichnet gekleidet. Die Art, wie er redet, hätte man früher als wohlbedacht bezeichnet – und er hat sie sich im Image-süchtigen Filmgeschäft zum Markenzeichen gemacht: Die lange Betonung einer einzigen Silbe, die Pause, die er als Waffe benützt, wenn er den Bösen spielt. Seine Augen funkeln und man fragt sich, ob dieses Lächeln das eines Haifischs ist, kurz bevor er sein Opfer verschlingt. Und ob der Hai auch Maßschuhe ohne Socken trägt.
Fragen zu seinem Privatleben ignoriert der Vater von vier Kindern. Es gibt Punkte, die er einfach kommentarlos abklemmt. Er lässt raus, dass er sein Leben von Berlin und London nun in die – mehr standesgemäß gewordenen – Hügel über Malibu verlegt hat. Ja, sagt er, das Leben hätte sich verändert, durchaus zum Guten. Das Leben als erfolgreicher Filmstar habe ja auch seine guten Seiten. Unter anderem, dass man sich die besseren Geschichten aussuchen könne.
Und nun „Alita“, ein Superhero-Movie. „Was mich an ‚Alita‘ so fasziniert, ist, dass die Grundprinzipien des Dramas seit Tausenden von Jahren funktionieren. Weil die letzten paar hundert Millennien in der Evolution des Menschen keinen so großen Unterschied gespielt haben und unser Geist immer noch auf diesen uralten Prinzipien basiert. Moderne Technologie hingegen möchte uns glauben machen, dass wir diesen Prinzipien nicht mehr unterworfen sind. Da kommt es zum Konflikt, und diese Geschichte erzählt uns ‚Alita‘. Ein wahrhaft faszinierender Film.“
Fühlt er sich besser als Ito, seiner Rolle in „Alita“, aufgehoben als in der Haut von Hans Landa? „Ich bin Schauspieler von Beruf und nicht der Verbreiter meiner Auffassungen“, beschwert er sich. Er identifiziere sich mit den Rollen, während er vor der Kamera steht. Ein Film sei ganzheitlich und nicht das Werturteil über einzelne Charaktere, die ein großer oder kleiner Aspekt einer Geschichte seien. Grundsätzlich sieht er jedoch die Schauspielerei als eben solche an: das Vorspielen einer anderen Realität. Das hat er nicht nur am Max Reinhardt Seminar, bei Lee Strasberg und Stella Adler in New York gelernt, das liegt ihm im Blut. Waltz stammt aus einer Theaterfamilie, seine Mutter war Kostümbildnerin, der Vater Bühnenbildner, die Großeltern Schauspieler am Burgtheater. Einer der Großväter war Psychologe und Psychiater. Vielleicht stammt von daher Waltz‘ Bestreben, einen deutlichen Abstand von dem zu halten, was vorgegaukelt wird – eine Vorbereitung auf ein Leben in Hollywood.
Aber er hat schon Lieblingsrollen, wie die Rolle des Alan in Polanskis „Der Gott des Gemetzels“. Die sei in sich geschlossen und würde den Erzählprinzipien gerecht. Polanski sei für ihn eh einer der ganz großen Regisseure. „Ich bewundere ihn ohne Wenn und Aber. Ich finde nicht jeden Film toll, den er macht. Aber als Regisseur, als Filmdenker ist das Niveau fast undenkbar hoch.“
„DENN DAS, WAS DICH TREIBT, ETWAS ZU WERDEN, IST IN KEINER WEISE DAS, WAS DICH NACH DEINEN ERFAHRUNGEN DAZU BEWEGT, DRAN ZU BLEIBEN.“
„Ich bin ein Dranbleiber“, sagt Christoph Waltz. Er war eigentlich immer beschäftigt, konnte so seinen Lebensunterhalt verdienen und war dadurch privilegiert in diesem Beruf. „Stimmt!“ Aber der große Durchbruch kam spät, „sehr!“ Wie motiviert man sich, wenn man in der Blüte seiner Jahre steht, wie es so schön heißt – und wenn die Rollen nicht so toll sind, aber die Miete bezahlt werden muss?
„Das unterscheidet die Echten von den Falschen“ sagt er, erklärt die Floskel aber im Nachhaken. „Wenn‘s mir nur um den Erfolg geht, dem Fremdbestimmten, dann ist es sicher klug, nach einer gewissen Zeit des Misserfolgs, besser des sich nicht einstellenden Erfolgs, die Segel zu streichen und was anderes zu machen. In der Schauspielerei, die ja nicht so leicht festzulegen ist, sondern viel mit Moment und Perspektive zu tun hat, erreicht man erst nach langer Erfahrung ein Niveau, auf dem die Sache möglich wird, das Handwerk im besten Sinne des Wortes. Eine solche Erfahrung bringt dich zu einem Punkt, der dir am Anfang noch gar nicht vorschweben mag, der dich fokussiert.“
Im Folgeschluss wären dann 20, 30 Jahre Erfahrung vor Fernsehkameras notwendig, um Polanskis „Alan“ zu spielen? Naja, lenkt er lächelnd ein, er sei ja auch getrieben von seinen Intentionen und erklärt eben diese in seiner sacht gestelzten Art und Weise: „Man muss eine Zeit verbringen mit einer Sache, um das herauszufinden, was man will. Denn das, was dich treibt, etwas zu werden, ist in keiner Weise das, was dich nach deinen Erfahrungen dazu bewegt, dranzubleiben. Man sieht die Welt heute anders, als wir sie gestern gesehen haben, und auf jeden Fall erleben wir sie heute anders, als wir sie vor zehn Jahren erlebt haben.“
Wünscht man sich dann, dass der Durchbruch früher gekommen wäre? „In bestimmter Hinsicht auf jeden Fall, in anderer nicht. Natürlich würde mir gefallen – wie jedem Menschen meines Alters –, vieles früher zur Verfügung zu haben, weil wir über mehr Energie verfügen, zukunftsfroher sind und mehr Dinge erledigt haben könnten. Andererseits ist es kindisch, weil es ist, wie es ist. Dieses Dranbleiben ermöglicht ja erst, dass es zur Zukunft kommt. Nix kommt von nix.“
„WENN‘S TARANTINO IST, WÜRDE ICH ES HEUTE AUCH NOCH MACHEN.“
Die Anfrage von Tarantino lief übrigens erstaunlich banal ab, meint er. Es gab einen Anruf vom Casting Director, dann kam das Drehbuch. Erst viel später traf er sich mit dem Regisseur – und da war es kein Vorsprechen mehr. Die „Audition „ war zum Gespräch mutiert. Tarantino hatte seinen Film gerettet, Waltz seine Karriere.
Die Machtverhältnisse haben sich mit zunehmendem Ruhm seitdem deutlich verändert.
Sie müssen nicht mehr jedes Drehbuch lesen, nicht mehr jede Rolle annehmen. Früher gab‘s sicherlich kein Nein, wenn Tarantino anruft, heute suchen Sie sich‘s raus, oder? „Wenn‘s Tarantino ist, würde ich es heute auch noch machen. Was nicht heißt, dass ich mich nicht dafür interessiere, was es ist. Die Verhältnisse mögen sich verschoben haben, aber bei mir hatte das nur die Auswirkung, dass ich noch sturer geworden bin. Dass ich noch dranner bleibe als vorher.“ Er würde überall arbeiten, sagte er einmal zur „New York Times“, aber nicht mehr an allem.
Diese österreichische Sturheit sollte man nicht unterschätzen. Als Christoph Waltz sich vor einigen Jahren mit einer Inszenierung des „Rosenkavalier“ in Antwerpen als Opernregisseur versuchte, erntete er für seine extrem reduzierte Inszenierung zum Teil böse Verrisse. Einige Zeit später versuchte er es noch einmal, mit Verdis „Falstaff“, mit deutlich besseren Resultaten. Ein paar Narben sind jedoch geblieben. Vor Kurzem führte er Regie im Film „Georgetown“, einem Krimi mit Annette Benning und Vanessa Redgrave. Er will aber nicht wirklich über das Projekt reden. „Es ist ein seltsamer Zustand“, meint er zögerlich. „Es gibt schon Geld, das wird aber nur für sehr spezielle Filme ausgegeben und unter der Bedingung des kommerziellen Erfolgs, wobei ironischerweise genau dieser Punkt am schlechtesten zu verargumentieren ist. Jeder behauptet ja, er wüsste, was zum Erfolg führt. Das ist aber nicht zu greifen, sonst wären wir alle sehr reich. Das Netflix-Modell zum Beispiel ist aufgrund der Tatsache, dass es auf Statistik beruht, eine Annäherung daran. Aber auch Börsenspekulationen basieren auf Statistiken, und selbst die funktionieren nicht immer. Im Augenblick wird mit einer Inbrunst jeder Inhalt vorauseilend dem Kommerz geopfert, was das Erzählen von Geschichten immer schwieriger macht.“
Sagt der Schauspieler, der in einem hyper-kommerziellen Superhelden-Film mitspielt. Das sei im Falle von James Camerons „Alita“ etwas differenzierter zu sehen. Der Film bietet für Waltz eine immens vielschichtige Story, eine facettenreiche Erzählung mit ständig wechselnden Perspektiven. „Als Ganzes gesehen ist es ein Riesenspektakel mit einem irren Unterhaltungswert, der als Erzählung hält.“
Einen Vergleich mit anderen großen Schauspielern, die ihre Seele an die diversen Comic-Universen für Ruhm und Einkommen verkauften, weist er von sich. Ob die sogenannten Verräter an der guten Sache nun zu schlechteren Schauspielern geworden seien, nur weil sie Rollen als Comic-Figuren angenommen hätten, fragt er zurück. „Oder ist es nicht so, dass Sie den Schauspieler gerne dahin projizieren, wo er nicht ist? Sie versetzen sich in die Lage dieses Schauspielers. Was im Prinzip der ideale Vorgang zwischen Schauspieler und Zuschauer ist.“
Kann man denn auf der einen Seite bei „Falstaff“ Regie führen und auf der anderen bei „Alita“ den Ito spielen? Wo ist die Verbindung? „Die bin ich. Und es ist das, was mich umtreibt und was mich interessiert, wo ich versuche, für mich Klarheiten zu schaffen. Ich versuche nicht, für Sie Klarheiten zu schaffen, aber ich möchte gerne, dass Sie das mit mir teilen.“
Quelle: rampstyle #17
- Tags:
- gepostet am: Freitag, 14. Dezember 2018